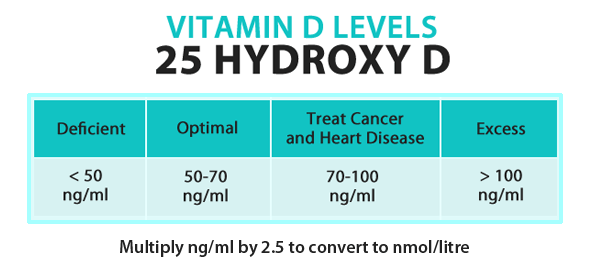Kopfschmerz ist eine Volkskrankheit
Kopfschmerzen sind in der Gesellschaft ein verbreitetes und für die Betroffenen mitunter ernsthaftes Problem, das viele Menschen in ihrem Alltag stark einschränkt. Studien haben gezeigt, dass etwa 95 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben an Kopfschmerzen leiden. Interessanterweise gilt diese Zahl nicht nur für Deutschland. Die Häufigkeit der Erkrankung ist in allen Teilen der Welt ungefähr gleich.
Kopfschmerzen im Überblick:
- Es gibt viele verschiedene Arten von Kopfschmerzen und daher unterschiedlichste Behandlungsansätze. Die richtige Diagnosestellung durch Erfassung der Krankengeschichte und ärztliche Untersuchung ist das A und O.
- Man unterscheidet den Kopfschmerz als Erkrankung (Primäre Kopfschmerzen) vom Kopfschmerz als Symptom (Sekundäre Kopfschmerzen)
- Kopfschmerzsymptome werden von den Patienten sehr unterschiedlich beschrieben
- Neben schmerzstillenden Medikamenten können auch pflanzliche Heilmittel helfen
Bei genauerer Betrachtung stellt sich die Erkrankung sehr komplex dar. Tatsächlich gibt es laut der
Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft über
250 voneinander abgrenzbare Kopfschmerzarten.
Um sich in diesem Durcheinander zurechtzufinden, teilt man die Kopfschmerzen grob in zwei verschiedene Gruppen ein.
Primäre Kopfschmerzen stellen die eigentliche Erkrankung darstellen, wie etwa
Migräne oder
Spannungskopfschmerz.
Sekundäre Kopfschmerzen sind im Gegensatz dazu wesentlich seltener und lediglich das
Symptom eines Grundleidens. Mit der Heilung der Grunderkrankung lassen auch die Kopfschmerzen nach. Typische Erkrankungen, die mit Kopfschmerzen einhergehen, sind Kopfverletzungen, Infektionserkrankungen, Blutgefäßleiden oder auch bei Substanzgebrauch- oder Entzug. Die Grippe zum Beispiel weist als klassisches Symptom Kopfschmerz auf. Dieser lässt erst dann nach, wenn der Körper die Oberhand über die Grippeviren gewinnt. Die Linderung des sekundären Kopfschmerzes bedarf also in diesem Fall der
Behandlung der Grunderkrankung.
Sollten Ihre Kopfschmerzen Sie daran hindern, Ihrem Alltag wie gewohnt nachzugehen, ist ein Arztbesuch ratsam. Hat dieser Ihren Kopfschmerz richtig eingeordnet, kann er eine geeignete
Therapie einleiten, die Ihnen dabei hilft, wieder entspannter durchs Leben gehen zu können.
UrsachenUrsachen. Von Genen und Nerven
Es gibt nur wenige primäre Kopfschmerzarten, deren Ursachen bekannt sind. Schon die
Vielfalt der Symptome zum Beispiel bei der Migräne spricht dafür, dass viele verschiedene Mechanismen zur Schmerzentstehung beitragen. Fest steht allerdings zumindest für die
Migräne, dass
genetische Faktoren eine Rolle spielen. So konnten für die seltene Unterart der familiären hemiplegischen Migräne in experimentellen Studien bestimmte Genveränderungen bei den Betroffenen für die Erkrankung verantwortlich gemacht werden, die die familiäre Häufung bei diesem Leiden erklären. Es ist also noch viel Forschungsarbeit auf diesem Gebiet nötig, um konkrete Ursachen für Kopfschmerzen zu entdecken. Dieses Wissen wird dann auch den Weg für
neue individuelle Therapieverfahren bereiten können.
Sehr viel besser verstanden ist der Mechanismus der Schmerzentstehung beim Kopfschmerz. Dazu muss man sich vor Augen führen, dass das
Gehirn selbst nicht schmerzempfindlich ist. Nach einem Sturz auf den Kopf zum Beispiel treten meist Kopfschmerzen auf ohne dass das Gehirn beschädigt ist. Dies passiert nur selten. Die Strukturen, die bei einer solchen Gehirnerschütterung den Schmerz vermitteln, sind die das Gehirn umgebenden Häute, die sogenannten
Meningen. Einer der großen Hirnnerven, der
Nervus Trigeminus, gibt nämlich sensible Nervenfasern in Richtung der Hirnhäute ab.
Aber nicht nur die Meningen sind durch ihre Versorgung durch den Nervus Trigeminus schmerzempfindlich. Dieser versorgt ebenso die Gesichtshaut und die Schleimhaut der Nasennebenhöhlen. Das erklärt, warum sich eine
Nasennebenhöhlenentzündung häufig durch Kopfschmerzen äußert.
Bei chronischen Kopfschmerzen ist die
Schmerzschwelle, also die
Intensität, ab der ein Reiz als schmerzhaft empfunden wird, oftmals gesenkt. Dies kann Teil der Erkrankung sein, wie es bei der
Migräne und beim
Spannungskopfschmerz vermutet wird, oder durch unabhängige Faktoren wie eine
Depression bedingt sein.
Von den Ursachen der Kopfschmerzen zu unterscheiden sind ihre spezifischen Auslöser, die auch als
Triggerfaktoren bezeichnet werden. Über Triggerfaktoren wie Stress, hormonelle Schwankungen (etwa im Rahmen des Menstruationszyklus der Frau) oder auch häufige Änderungen im Schlaf-Wach-Rhythmus berichten insbesondere Migränepatienten. Das Führen eines Kopfschmerzkalenders kann dabei helfen, die persönlichen Kopfschmerzauslöser zu ermitteln. Diese zu kennen, ist ein
wichtiger Teil der Therapieplanung, denn man kann zum Beispiel mit Entspannungsverfahren gezielt dem wichtigen Triggerfaktor Stress vorbeugen, bevor er zu Kopfschmerzen führt.
SymptomeSymptome. Kopfschmerz ist nicht gleich Kopfschmerz
Bedingt durch die Vielzahl an verschiedenen Kopfschmerzerkrankungen, zeigen sich die Symptome vielgestaltig. Folgende Darstellung verschafft einen Überblick, welche Schmerzeigenschaften für den Arzt bei der Stellung Der Diagnose interessant sind.
Der Schmerzcharakter. Dem anhaltenden Spannungskopfschmerz stehen attackenartige Kopfschmerzen wie bei der
Migräne gegenüber, den Betroffene als bohrend oder pulsierend wahrnehmen. Ein sogenannter
„Donnerschlagkopfschmerz“ legt den Verdacht einer zwar seltenen, aber schwerwiegenden Hirnblutung nahe, deren Ursache der Riss eines Gehirnaneurysmas (Erweiterung eines Blutgefäßes im Gehirn) sein kann.
Häufigkeit und Dauer der Schmerzepisoden. Migräne zum Beispiel äußert sich in 4 bis 72 Stunden währenden Attacken, die mehrfach im Monat vorkommen können, in schwereren Fällen auch mehrfach pro Woche. Der
Clusterkopfschmerz hingegen tritt vorwiegend im Winter innerhalb von 6 bis 8 Wochen auf, die Episoden dauern zwischen 5 und 180 Minuten.
Der Schmerzort. Während
Spannungskopfschmerzen häufig über den ganzen Kopf empfunden werden, tritt die Migräne häufiger hinter der Stirn und eher einseitig auf.
Typische Begleiterscheinungen
Während einer Migräneattacke treten oft Lichtscheue und
Appetitlosigkeit auf, körperliche Unruhe bei Clusterkopfschmerz. Gleichzeitig mit einem neuen Kopfschmerz auftretendes
Fieber und Schwächegefühl sind ein Alarmzeichen für eine Infektion und sollten Sie zum Arztbesuch veranlassen.
Leiden Sie schon länger an Kopfschmerzen, ist Ihnen die eigene Symptomatik bestens vertraut. Deshalb
können Sie auch sehr genau einschätzen, wenn sich diese ändern. Dies ist gelegentlich ein
Zeichen dafür, dass sich auch Ihre Erkrankung im Wandel befindet.
Mischformen von Kopfschmerzen sind nicht selten und entwickeln sich meist im Laufe der Jahre. Sie sind besonders schwer zu behandeln. Deshalb ist es ratsam, frühzeitig einen Arzt aufzusuchen, wenn sich der Charakter eines lange bekannten Kopfschmerzes mit der Zeit ändert.
Mehr als 90% der Kopfschmerzen lassen sich durch die folgenden Erkrankungen erklären.
Häufigste Kopfschmerzarten
Migräne (häufig)
- Attackenartiger Halbseitenkopfschmerz mit stechend-pulsierendem Charakter
- Dauer des Anfalls etwa 4 bis 72 Stunden
- Typische Begleitsymptome: Appetitlosigkeit, Übelkeit, Lichtscheu, starkes Ruhebedürfnis
- Ankündigung einer Attacke durch eine Aura möglich (Aura: vorübergehende Sehstörungen, Kribbeln auf der Haut, Lähmungserscheinungen)
Spannungskopfschmerz (häufig)
- leichte bis mittelgradige Kopfschmerzen mit drückend-beengendem Charakter
- Schmerzdauer: 30 Minuten bis 7 Tage
- Schmerzbeginn oft morgens, Intensität nimmt im Laufe des Tages zu
- selten typische Begleitsymptome wie bei der Migräne
Cluster-Kopfschmerz (selten)
- streng einseitiger, vor allem nachts in den Wintermonaten auftretender Kopfschmerz mit bohrendem Charakter
- Schmerz wird vor allem um die Augen herum sowie an Stirn und Schläfe empfunden
- Schmerzdauer: 5 bis 180 Minuten, mehrere Attacken täglich möglich
- Begleitsymptome: Augentränen, Augenrötung, starke Bewegungsunruhe während der Attacke
- Männer sind wesentlich häufiger betroffen als Frauen
Durch Schmerzmittel ausgelöster Kopfschmerz
- Diffuser, meist beidseitiger Kopfschmerz mittlerer Intensität mit pulsierendem Charakter
- Auslöser: Schmerzmitteleinnahme an mindestens 10 Tagen pro Monat, insbesondere Triptane (Schmerzmittel, die bei Migräne eingesetzt werden)
DiagnoseDiagnose. Gut vorbereitet zum Arzt
Die ärztliche Befragung (Anamnese), am besten beim Neurologen, ist der wichtigste Schritt zur richtigen Diagnose. Eine
neurologische Untersuchung dient dazu, Schädigungen des Nervensystems auszuschließen. Es ist ratsam, sich im Vorfeld die eigene Kopfschmerzgeschichte zu vergegenwärtigen und aufzuschreiben, damit man dann im Sprechzimmer nichts Wichtiges vergisst. Auch das
Führen eines Kopfschmerzkalenders kann hilfreich sein. So kann der Arzt abschätzen, wie häufig Sie unter den Beschwerden leiden. Notieren Sie sich, welche Maßnahme bei einer Schmerzepisode für Linderung gesorgt hat. Auf diese Dinge wird Ihr Arzt beim ersten Gespräch eingehen, deshalb sollten Sie hier gut gerüstet sein.
Wenn der Verdacht entsteht, der Schmerz könnte mit einer anderen Erkrankung zusammenhängen, können weitere Untersuchungen nötig sein. Blutdruckentgleisungen, die mitunter Kopfschmerzverursacher sind, können mit einer einfachen Blutdruckmessung festgestellt werden. Bildgebende Verfahren wie CT (Computertomographie) und MRT (Magnetresonanztomographie) dienen dem Ausschluss von Blutungen und Hirntumoren, die im Übrigen entgegen dem Volksglauben eher selten zu Kopfschmerzen führen.
Auf Blutentnahmen und Laboruntersuchungen kann im Sinne der Diagnostik bei Kopfschmerzen in den meisten Fällen verzichtet werden. Die Entnahme von Hirnwasser aus dem Rückenmark (Lumbalpunktion) wird notwendig, wenn aufgrund der neurologischen Untersuchung der Verdacht auf eine Infektion der Hirnhäute (Meningitis) fällt. Da sekundäre Kopfschmerzen nur etwa 10% der Kopfschmerzerkrankungen ausmachen, sind diese zusätzlichen Untersuchungen in den meisten Fällen verzichtbar.
TherapieSchmerztherapie. Leben ohne Kopfschmerz
Schmerzstillende Medikamente. Kopfschmerzen können in der Regel gut mit nicht-verschreibungspflichtigen schmerzstillenden Mitteln wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen oder Paracetamol in
Selbstmedikation behandelt werden. Diese Mittel müssen jedoch ausreichend dosiert und sparsam eingesetzt werden, da auch sie Nebenwirkungen haben. Nimmt man Schmerzmittel häufiger als an 10 Tagen im Monat ein, kann dies die Schmerzen verschlimmern. Paradoxerweise kann nämlich ein zu häufiger Gebrauch selbst zu Kopfschmerz führen, der dann auch nur schwierig in den Griff zu bekommen ist.
Wichtig zu wissen:
Nicht jeder Wirkstoff ist für jeden Patienten geeignet. Schwangere sollten bei Schmerzmitteleinnahme besonders achtsam sein und vorsichtshalber ihren Arzt konsultieren, bevor sie zu diesen Präparaten greifen. Welches Schmerzmittel sich bei Ihren Beschwerden eignet, erfahren Sie auch in der Apotheke Ihres Vertrauens.
Treten Kopfschmerzen häufig auf, kann die Einleitung einer
medikamentösen Prophylaxe hilfreich sein. Besonders bei
Migräne und
Spannungskopfschmerz hat sich diese Strategie bewährt, um die Häufigkeit von Schmerzepisoden zu senken.
Nichtmedikamentöse Verfahren. Sport und Entspannungstherapien können wirksame Ansätze sein, Kopfschmerzen ohne Medikamente zu behandeln. Studien haben gezeigt, dass die Ausübung eines milden Ausdauersports wie Nordic Walking oder Schwimmen zu weniger Kopfschmerztagen führen können. Auch Entspannungstechniken wie die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson oder autogenes Training helfen, die Grundspannung des Körpers zu senken und den Stress als Triggerfaktor für Kopfschmerz zu verringern.
Diese Techniken selbst zu erlernen, ist allerdings nicht einfach. Wie beim Yoga ist es hier wichtig, dass Sie sich das Verfahren zuvor zum Beispiel in einem Kurs unter Anleitung erlernen, ehe Sie es im Alltag erfolgversprechend einsetzen können. Richtig umgesetzt, sind solche Entspannungsverfahren also ein guter Weg, um
Stress im Alltag abzubauen.
Vorbeugend gegen Kopfschmerzen hilft außerdem ein
geregelter Tagesablauf, da ein gestörter Tag-Nacht-Rhythmus mit unregelmäßigen Ruhezeiten den Schmerz auslösen kann. In spezialisierten Kopfschmerzzentren hat man zudem gute Erfahrungen damit gemacht, auch eine psychologische Betreuung der Patienten in die Behandlung einzubetten. Letztendlich ist es wichtig, dass diese vielen Therapieebenen parallel angegangen werden, um dem Kopfschmerz erfolgreich entgegentreten zu können.
Kopfschmerzen plagten die Menschen natürlich schon, als es noch keine Schmerzmedikamente gab, die man sich an Migränetagen mal eben aus der Apotheke holen konnte. Traditionelle Arzneien auf pflanzlicher Basis helfen auch heute noch. Vor allem bei Migräne und Spannungskopfschmerz können Heilpflanzen wirksam sein.
Pflanzliche Wirkstoffe bei Kopfschmerzen

Die schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung der
Weide ist in der Volksmedizin schon lange bekannt. 1828 gelang es, in der Weidenrinde den Stoff Salicin zu identifizieren und schließlich, Ende des 19. Jahrhunderts, im Labor nachzubauen. Das erste synthetische Schmerzmittel war geboren, die
Acetylsalicylsäure, kurz ASS.
Zubereitungen aus reiner Weidenrinde werden vor allem
bei chronischen Kopfschmerzformen angewandt. Genutzt wird in verschiedenen Darreichungsformen die
getrocknete Rinde junger Weidenzweige. Diese kann beispielsweise als Tee zubereitet werden. Dazu bringt man einen Teelöffel geschnitter Rinde in 250 ml Wasser zum Kochen und nimmt den Topf dann sofort von der Herdplatte und lässt den Tee fünf Minuten ziehen. Je nach Bedarf kann er mehrmals täglich getrunken werden.
Auch der Extrakt der Weidenrinde kann zur Schmerzlinderung herangezogen werden. Entsprechende Fertigarzneimittel erhält man in der Apotheke. Diese beinhalten neben Salicin auch andere Stoffe, deren Zusammenspiel eine in vielen Studien nachgewiesene schmerzstillende Wirkung hat.
Ganz frei von Nebenwirkungen ist das „natürliche Aspirin“ leider nicht. So kann Weidenrinde zu
Hautreizungen und allergischen Reaktionen führen. Die für Acetylsalicylsäure typische unerwünschte Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt (Magengeschwür) und auf das Blut (Gerinnungshemmung und damit verbundene Blutungsneigung) treten bei der Anwendung der Weidenrinde hingegen selten auf. Schwangere sollten Zubereitungen mit Weidenrinde meiden, da das Herz-Kreislauf-System des Kindes geschädigt werden kann.

Die gewöhnliche
Pestwurz kam zu ihrem Namen, weil ihr im Mittelalter eine Wirkung gegen die Pest nachgesagt wurde. Auch heute noch werden Extrakte aus dem Wurzelstock der Pestwurz bei verschiedenen Leiden eingesetzt, so zum Beispiel bei der Migräne. Die Pflanze besitzt nämlich
entzündungshemmende, krampflösende und schmerzstillende Wirkungen, die sich für die Migränevorbeugung eignen.
Allerdings ist vor der unverarbeiteten Zubereitung beispielsweise in Tees zu warnen, da die Pflanze
im Rohzustand leberschädigend wirken kann. Deshalb sind Pestwurz enthaltende Arzneimittel (zumeist Kapseln) auch apothekenpflichtig. Zur Akuttherapie von Kopfschmerzen können sie allerdings nicht wirksam eingesetzt werden, da nur für die langfristige Einnahme ein Effekt nachgewiesen ist.

Die im
Lavendel enthaltenen ätherischen Öle wirken
entspannungsfördernd und
krampflösend in verschieden Bereichen des Körpers. In Duftlampen, Duftkissen und Tees entfaltet der Pflanzenextrakt seine Wirkung und kann bei Kopfschmerzattacken Linderung verschaffen.

Pfefferminzöl wird von vielen Kopfschmerzpatienten angewandt, da es im Gegensatz zu synthetischen schmerzstillenden Schmerzmitteln keine Nebenwirkungen aufweist und trotzdem bei akuten Kopfschmerzen eine ähnlich gute Wirkung wie diese Medikamente haben kann.
Das ätherische Öl der
Pfefferminze ist für seine
schmerzlindernde und kühlende Wirkung bekannt. Es ist in der Apotheke in Form eines Rollstifts erhältlich, der eine einfache Anwendung auf die Haut ermöglicht. Vor allem bei
Spannungskopfschmerz, aber auch bei einer
Migräneattacke, wird Pfefferminzöl äußerlich auf Stirn und Schläfen aufgetragen. Im Schmerzfall
frühzeitig angewandt kann es auf diese Weise sogar ein Schmerzmittel in der Anfallsbehandlung entbehrlich machen und so einem durch Schmerzmittel verursachten Kopfschmerz vorbeugen.
Wann zum Arzt?
Wenn Sie bei sich oder einem ihrer Angehörigen die folgenden Symptome bemerken, ist eine ärztliche Untersuchung ratsam:
- Kopfschmerzen an mehr als 10 Tagen pro Monat
- Erstmalig auftretende Kopfschmerzen im Alter von über 40 Jahren
- Kopfschmerzen nach Sturz auf den Kopf
- Die Schmerzen nehmen trotz Behandlung an Stärke, Häufigkeit und Dauer zu
- Bewährte Medikamente wirken nicht mehr
- Begleiterscheinungen wie Lähmungen, Sehstörungen, Schwindel, Fieber oder Übelkeit treten auf
- Kopfschmerzen bei Kindern
- Schwangere sollten vor Schmerzmitteleinnahme den Arzt aufsuchen
Link- und Buchtipps:
- Göbel H. Erfolgreich gegen Kopfschmerzen und Migräne. 5. Auflage: Springer; 2010
- Patienteninformation der DMKG

- Kopfschmerzkalender als Download

Quellen:
- Therapieempfehlungen der Deutschen Kopfschmerz- und Migränegesellschaft e. V. (DMKG)
- Kothe H W. 1000 Kräuter. 1. Auflage: Naumann und Göbel; 2006
- Mumenthaler M Mattle H. Neurologie. 12. Auflage: Thieme; 2008
- Göbel H. Erfolgreich gegen Kopfschmerzen und Migräne. 5. Auflage: Springer; 2010
- Homepage der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e. V.